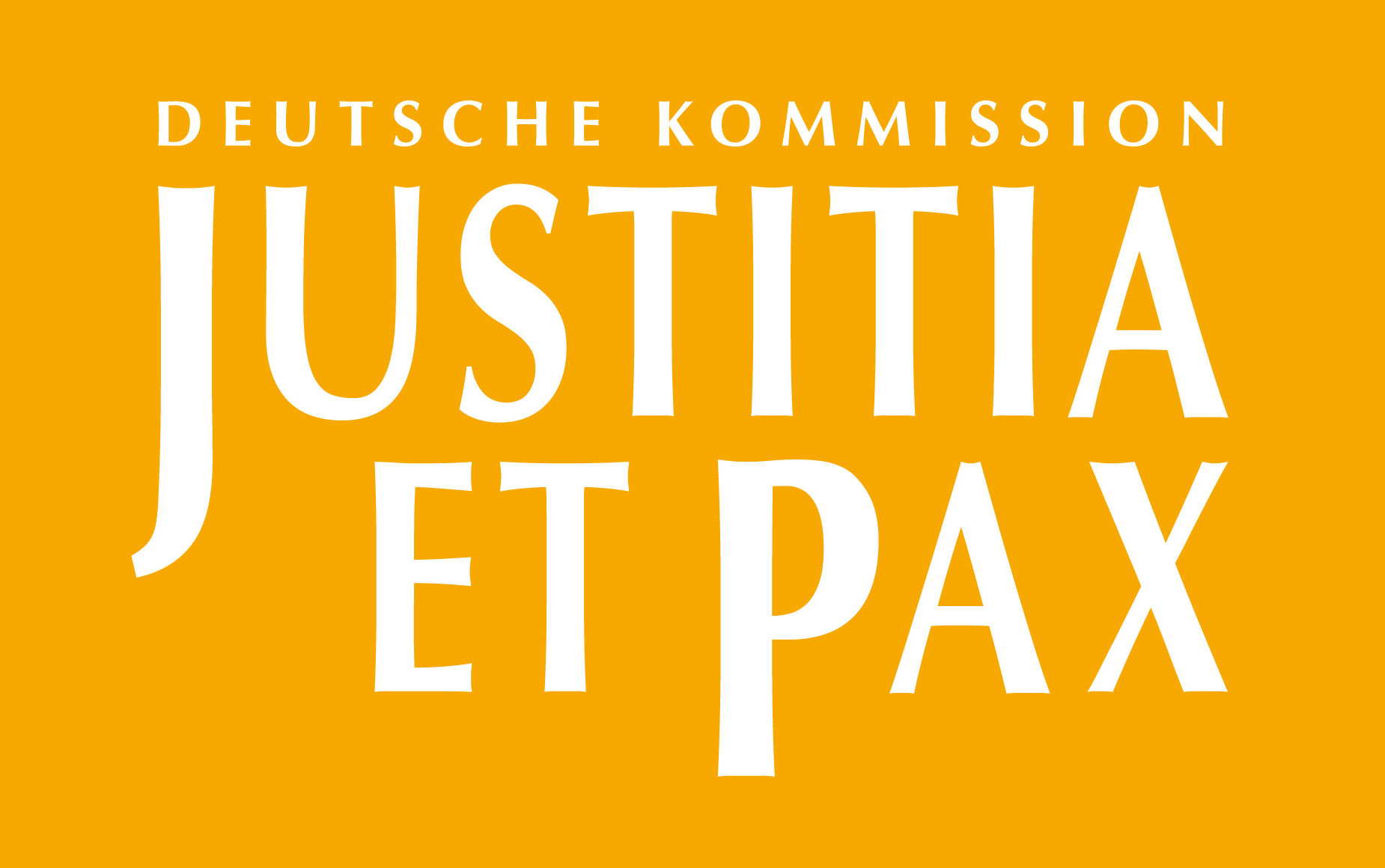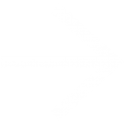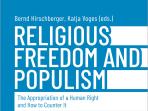Autoritatismus und Rechtsextremismus
© Himsan_13 / pixabay
Menschenrechte unter Druck durch Autoritarismus und Rechtsextremismus
Gut 75 Jahre nach Verabschiedung der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte (AEMR) stehen die Menschenrechte vielfach unter Druck – auch und vor allem durch autoritäres und rechtsextremes Denken, Bewegungen und Parteien. Das zeigt sich in Deutschland, in Europa und weltweit in je unterschiedlichen Ausprägungen.
Trotz der großen Heterogenität der Entwicklungen in verschiedenen Regionen, gibt es Gemeinsamkeiten. Sowohl die Universalität (Gelten Menschenrechte für alle und überall?) als auch die Unteilbarkeit der Menschenrechte (Gelten wirklich alle Menschenrechte? Beispiel: Freiheitsrechte werden in Gegensatz zu sozialen Rechten gebracht) werden in Frage gestellt.
Gerade wenn menschenrechtliche Ansprüche mit konkurrierenden Interessen oder auch kollidierenden Normen konfrontiert sind, kommt es häufig zu emotionalisierten Spannungen in der Gesellschaft. Insbesondere autoritäre und populistische Kräfte instrumentalisieren die Spannungen zwischen verschiedenen Ansprüchen gerne und nutzen sie, um daraus Kapital für eigene machtpolitische, wirtschaftliche oder ideologische Zwecke zu schlagen, anstatt einen schonenden Ausgleich zwischen ihnen anzustreben. Besonders deutlich wird dies bei den Themenfeldern Sicherheit, Wohlstand und Identität:
- Das Scheitern von Rechtsstaat und liberaler Demokratie und sich verändernde Bedrohungslagen führen in verschiedenen Staaten weltweit zur Abkehr von Menschenrechten: Das Versprechen von Sicherheit geht mit einer „harten Hand“ und der Beschränkung von Freiheitsrechten einher. Auch in Europa verschärft sich ein Sicherheitsdenken und führt zu menschenrechtlichen Einschränkungen etwa im Asylbereich.
- Ängste vor Transformation insgesamt und vor Wohlstandsverlusten insbesondere (oft in Verbindung gebracht mit der notwendigen sozial-ökologischen Transformation) sind ein Faktor, der rechten Bewegungen und Parteien Zulauf beschert. Eine wachsende Mentalität „we first“ scheint internationale Solidarität zunehmend zu erschweren. Das zeigt sich in der Entwicklungspolitik aber auch in der Wirtschaftspolitik. Es wird in verschiedenen Ländern weltweit in Kauf genommen, dass für das Versprechen von Wohlstand Freiheitsrechte beschnitten werden.
- Rechtsextremismus ist u.a. dadurch gekennzeichnet, dass er bestimmte Gruppen ausschließt: Von Teilhalbe und von Rechten. Auch über diese direkten Ausschließungen hinaus spielen Gruppenzugehörigkeit und die Konstruktion von Identität eine wichtige Rolle in der aktuellen Gefährdung von Menschenrechten. In einem identitären Denken wird die pluralistische Gesellschaft und liberale Vorstellungen zum Feindbild, was sich etwa im Blick auf Genderfragen zeigt. Weltweit wird ausgehend von Identitätsfragen häufig die Universalität von Menschenrechten in Fragen gestellt.
In den kommenden Jahren wird die Deutsche Kommission Justitia et Pax mit der Unterstützung einer interdisziplinären Arbeitsgruppe diese Entwicklungen untersuchen und Handlungsempfehlungen für Gesellschaft, Politik und Kirche entwickeln. Dabei sollen sowohl internationale als auch nationale Entwicklungen sowie Wechselwirkungen zwischen den verschiedenen Ebenen analysiert werden. Dabei stehen die folgenden Leitfragen im Vordergrund:
- Wie werden Universalität und Unteilbarkeit in Frage durch autoritäre Akteure in Frage gestellt?
- Wie setzen autoritäre Akteure verschiedene Menschenrechte unter Druck?
- Welche Strategien wenden populistische und extremistische Kräfte an, um einen konstruktiven Umgang mit den Spannungen zu unterbinden?
- Wie müssen Lösungsfindungsprozesse gestaltet werden, um konstruktiv und effektiv zu sein und idealerweise die Menschenrechte nicht nur zu wahren, sondern zu fördern? Wie müssen diese Strategien ausgestaltet werden, um im Wettbewerb mit populistischer Rhetorik und Vorgehensweisen bestehen zu können?
- Wie kann eine solche (Menschenrechts-)Politik erfolgreich kommuniziert werden?
- Welche Rolle kann Kirche spielen, um für konstruktive Modi der Lösungsfindung zu werben und Resilienz gegenüber autoritären Tendenzen zu schaffen?
Publikationen

Neue Publikation: “Religious Freedom and Populism - The Appropriation of a Human Right and How to Counter It” (Sammelband, Open Access)
Populismus stellt eine wachsende Bedrohung für die Menschenrechte dar. Sie werden vereinnahmt, verzerrt, in leere Worte oder sogar in ihr Gegenteil verkehrt. Der neu erschienene Sammelband analysiert diese problematische Entwicklung am Beispiel der Religions- und Weltanschauungsfreiheit und stellt Gegenstrategien vor.
Weitere Themen
- Ein angemessener Umgang mit den Toten ist ein grundlegendes menschliches Bedürfnis. Wird ein solcher Umgang nicht gewährleistet oder sogar gezielt verletzt, bringt dies nicht nur erhebliche psychosoziale Belastungen für die Hinterbliebenen mit sich, sondern destabilisiert dies auch die ganze Gesellschaft.
- Herder Korrespondez 7/2021
- Herder Korrespondenz 12/2023
- Die Volksrepublik Chinas ist mittlerweile einer der wichtigsten Akteure in der internationalen Politik. Dieser Aufstieg fordert die EU heraus, ihr Verhältnis zu China neu zu definieren. Hierzu will auch Justitia et Pax Impulse setzen.
- Die sozial-ökologische Transformation von Wirtschaft und Gesellschaft zielt auf ein gutes Zusammenleben aller Menschen in der Gegenwart und Zukunft unter Wahrung der planetarischen Grenzen ab. Wie dies gelingen kann, soll in der neuen Veranstaltungsreihe der Deutschen Kommission Justitia et Pax und der Katholischen Akademie in Bayern „Forum for Future and Transformation“ diskutiert werden.
- Für die Stärkung des Menschenrechts auf Gesundheit besteht noch großer Handlungsbedarf - das hat nicht zuletzt die Corona-Pandemie gezeigt. Die Versäumnisse bei der gerechten Verteilung von Impfstoffen sind dabei nur die Spitze des Eisbergs einer ganzen Reihe an grundlegenden Problemen.
- Seit Jahren stehen die internationale Ordnung und die Fundamente der globalen Sicherheitsarchitektur unter Druck. Die Kommission beschäftigt sich mit sicherheitspolitischen Ordnungsvorstellungen und bringt diese in einen Dialog mit weiteren Vorstellungen zur Zukunft der internationalen Ordnung.
- Die historischen Belastungen des Kolonialismus geraten unter den Bedingungen der Globalisierung zunehmend in den Blick politischer und kultureller Auseinandersetzungen. Sie sind eine der wichtigen politisch-kulturellen Herausforderungen.
- Der Krieg gegen die Ukraine fordert die Friedensethik und -politik auf verschiedenen Ebenen heraus. Auf der Basis der christlichen Friedenslehre bringt sich die Deutsche Kommission Justitia et Pax in diese Debatten ein.
- Die Deutsche Kommission Justitia et Pax und die Katholische Akademie Berlin veranstalten jährlich am 5. November, dem Gedenktag des Seligen Bernhard Lichtenberg eine Abendveranstaltung zu einem menschenrechtlichen Thema.
- Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) und die Deutschen Kommission Justitia et Pax arbeiten im Gesprächskreis Kirche und Gewerkschaft zusammen zu Fragen der menschenwürdigen Arbeit.
- Wiederholt hat sich die Deutsche Kommission Justitia et Pax mit dem Problem der Atomwaffen auseinandergesetzt. Dabei bewegt sie sich im Spannungsfeld der ethischen Verurteilung einerseits und der verteidigungs- und sicherheitspolitischen Aktivität andererseits.
- Die Evangelische Friedensarbeit und die Deutsche Kommission Justitia et Pax veranstalten den „Ökumenischen Friedensdialog“ jährlich am 23. Oktober im Wechsel zwischen den Städten Osnabrück und Münster
- Es besteht keinen Zweifel, dass die verschiedenen Formen organisierter Kriminalität ein zunehmendes sicherheitspolitisches Problem darstellen. Im Kontrast zu diesem Gefährdungspotential spielt die organisierte Kriminalität in der säkularen und kirchlichen Friedensethik bisher nur eine untergeordnete Rolle.
- Das Engagement für die Religions- und Weltanschauungsfreiheit bildet einen Basso Continuo in der Menschenrechtsarbeit der Deutschen Kommission Justitia et Pax. Justitia et Pax zeigt aktuellen Handlungsbedarf auf, klärt über gängige Missverständnisse zu diesem Menschenrecht auf und stellt Wege vor, das Menschenrecht zu stärken.
- Diese Resonanzgruppe arbeitet eng mit der Sachverständigengruppe Weltwirtschaft und Sozialethik der Deutschen Bischofskonferenz zusammen mit dem Anliegen, die Studien der Sachverständigen Gruppe in politische Dialogformate zu übersetzen.
- Eine realistische Friedens- und Versöhnungsarbeit muss einen konstruktiven Umgang mit dem Einfluss der Gewalt und ihrer Folgen auf die gegenwärtige Situation, unsere Mentalitäten, Ängste, Hoffnungen, Erinnerungen und Verletzungen entwickeln.