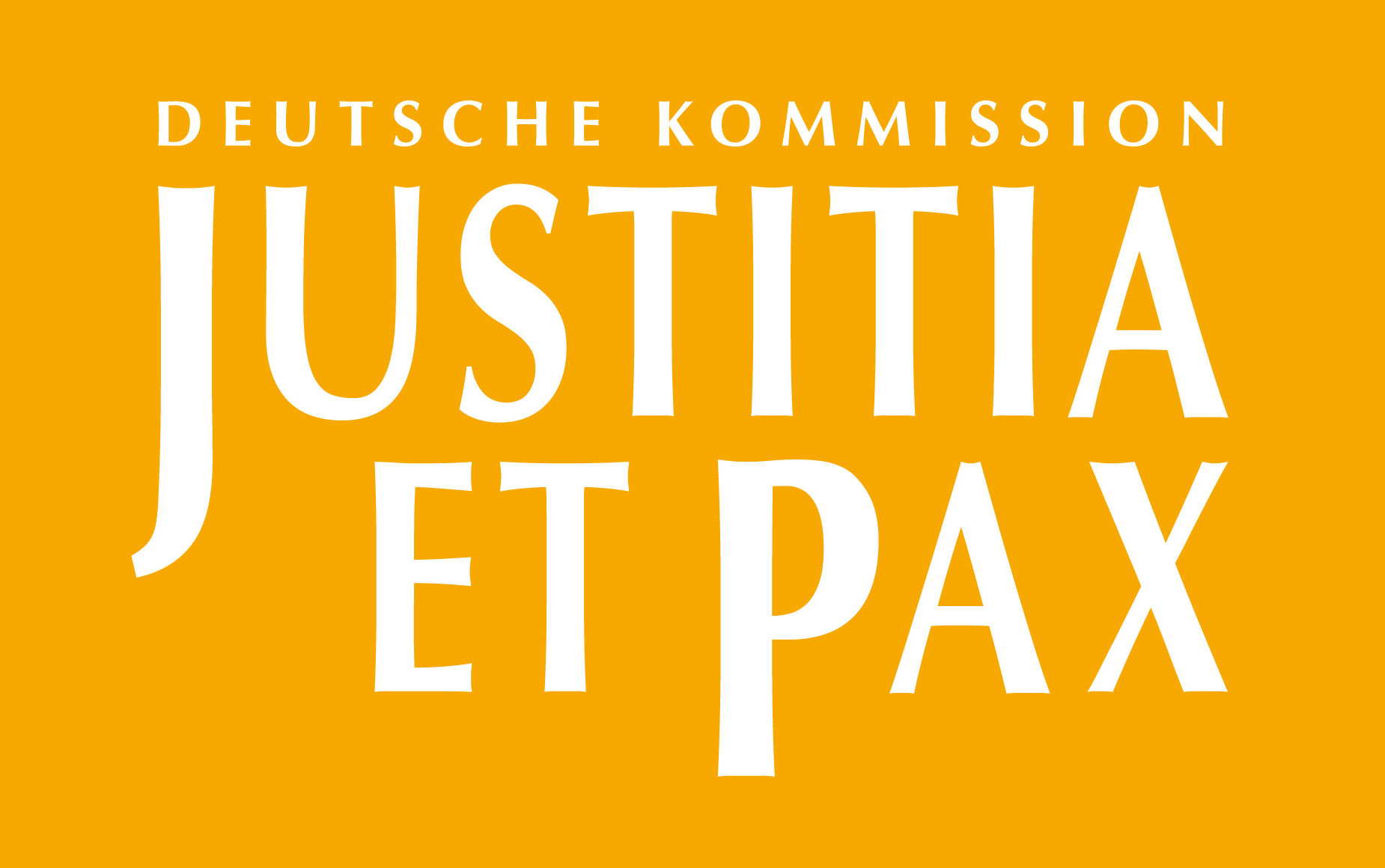Arbeitsprogramm 2024-2029
Die Deutsche Kommission Justitia et Pax, getragen von der Deutschen Bischofskonferenz und dem Zentralkomitee der deutschen Katholiken, versteht sich als kirchliches Forum und Akteurin, des gesellschaftlichen und politischen Dialogs zu den internationalen und globalen Fragen von Frieden, Menschenrechten und Entwicklung. Sie versteht ihre Tätigkeit als einen Beitrag zur weltweiten Sorge um das „gemeinsame Haus“ im Sinne einer ganzheitlichen menschlichen Entwicklung. Die Einsichten der Katholischen Sozial- und Friedenslehre, die aus vielfältigen Erfahrungen und deren Reflexion erwachsen ist, stellen einen orientierenden Bezugsrahmen für die Arbeit der Kommission dar. Die Kommission sieht sich als Teil dieses traditionsreichen kirchlichen Lern- und Handlungszusammenhangs.
Die Deutsche Kommission Justitia et Pax legt zu Beginn jeder Amtsperiode ein Arbeitsprogramm fest. Dieses setzt sich zusammen aus Themenfeldern der bisherigen Arbeit, die weitergeführt, und neue relevante Themen- und Handlungsfelder, die erschlossen werden sollen. Damit zeichnet sich das Arbeitsprogramm sowohl durch Elemente der Kontinuität als auch solche der Innovation aus. Beide Elemente sind für eine wirksame politische Dialog-Arbeit konstitutiv. Sie durchziehen alle Arbeitsbereiche. Mit Blick auf ihre spezifische Rolle im Zusammenhang der kirchlichen Werke, Einrichtungen und Verbände richtet die Kommission ihr Arbeitsprogramm an folgenden Kriterien aus: innovativ, exemplarisch, subsidiär, handlungsorientiert. Dabei zielt sie darauf, die erarbeiteten Themen und Ergebnisse nachhaltig und wirksam in politisches Handeln zu übersetzen
Entsprechend der Zielsetzungen werden langfristige Arbeitsgruppen und spezifische kurz- bis mittelfristigen Task-Forces eingesetzt. Die darüber hinaus bestehenden kontinuierlichen Gesprächs- und Handlungszusammenhänge (z.B. GKKE, MKS) stellen wichtige Instrumente der gemeinsamen Arbeit dar. Neben den langfristigen Arbeitsvorhaben wird sich die Kommission – wie bisher - auch immer wieder zu aktuellen Fragen äußern.
O. Politische Ausgangslage 2025 – Der Herausforderung des internationalen Autoritarismus konstruktiv entgegentreten
Wie nicht zuletzt im Wort der Deutschen Bischöfe „Friede diesem Haus“ (2024) herausgearbeitet wurde, befinden wir uns in einer Zeit einer Welt in Unordnung bzw. dynamischen multipolaren Konfliktordnung, die viele Dimensionen umfasst und die noch keineswegs eine berechenbare Form gefunden hat. Spätestens mit der Eskalation des Krieges gegen die Ukraine durch die Russische Föderation 2022 sind die Hoffnungen, dass man zeitnah zur internationalen Kultur des Multilateralismus zurückkehren könnte, gestorben. Die ermutigenden Projekte des Multilateralismus wie z.B. die Agenda 2030 und das Pariser Klimaabkommen sehen sich der grundlegenden Infragestellung durch eine erstarkende klassische Machtpolitik ausgesetzt. Eine Welt in wachsender Unordnung zeichnet sich ab, in der Menschenrechte, Frieden sowie nachhaltige Entwicklungsperspektiven für alle bedroht werden. Diese geschieht vor dem Hintergrund der drängenden Herausforderungen durch den Klimawandel. Wertvolle Zeit droht verloren zu gehen. Zugleich gewinnt der Rechtspopulismus auch in Deutschland zunehmend an Raum. Diese Entwicklung steht in einem engen Zusammenhang mit den Phänomenen der wachsenden globalen Unordnung und den daraus resultierenden Verunsicherungen und Versuchungen. Viele Menschen erleben Prozesse der Entfremdung und Entheimatung und antworten darauf mit einem gesteigerten Sicherheitsbedürfnis nebst Zuweisung des Bedrohungsgefühls an vulnerable Gruppen, „das System“, die „Medien“ oder schlicht „die da oben“. In dieser Erschütterung des gesellschaftlichen wie internationalen Zusammenhalts liegt ein wesentliches Zeichen der Zeit.
Gegen diese Trends will die Deutsche Kommission Justitia et Pax im Rahmen ihres Arbeitsprogramms konkrete Zeichen setzen und praktische Beiträge gegen die scheinbare Unausweichlichkeit der Gewalt und des Unrechts entwickeln. Dabei nimmt sie Maß an der für die Katholische Soziallehre zentralen Perspektive des Weltgemeinwohls sowie der menschlichen Sicherheit und konkretisiert sie anhand von spezifischen Themen.
I. Neue Schwerpunkte – konstruktive Antworten auf die Bedrohungen und Herausforderungen durch den internationalen Autoritarismus
Themenfelder
Themenfeld
1 Sicherheits-politische Ordnungsvorstel-lungen in
einer multipolaren Welt“
Themenfeld
2 „Menschenrechte unter Druck
durch Autoritarismus und Rechtsextremismus“
Themenfeld 3 „Sozial-ökolo-gische
Transformation und nachhaltige Entwicklung“
Themenfeld 1 „Sicherheitspolitische Ordnungsvorstellungen in einer multipolaren Welt“
Seit mehreren Jahren stehen die internationale Ordnung und mit ihr die Fundamente der internationalen Sicherheitsarchitektur unter wachsendem Druck. Vor diesem Hintergrund soll sich eine Arbeitsgruppe mit sicherheitspolitischen Ordnungsvorstellungen beschäftigen und diese in einen Dialog mit europäischen und katholischen Vorstellungen zur Zukunft der internationalen Ordnung bringen. Dabei sollen die Einsichten der Kommission aus der Beschäftigung mit China und Russland in den Prozess einfließen. Die Arbeitsgruppe soll eine Positionierung der Kommission im Themenfeld vorbereiten und die Grundlage für politische Dialoge schaffen.
Themenfeld 2 „Menschenrechte unter Druck durch Autoritarismus und Rechtsextremismus“
Gut 75 Jahre nach Verabschiedung der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte stehen diese durch autoritäres und rechtsextremes Denken, Bewegungen und Parteien in Deutschland, Europa und weltweit in je unterschiedlichen Ausprägungen unter Druck. Es lassen sich bezüglich der menschenrechtlichen Geltung vor allem eine Infragestellung des Universalitätsanspruchs und eine Infragestellung der Unteilbarkeitfeststellen. Insbesondere autoritäre und populistische Kräfte instrumentalisieren die Spannungen zwischen verschiedenen Ansprüchen, um daraus Kapital für eigene machtpolitische, wirtschaftliche oder ideologische Zwecke zu schlagen. Zur Auseinandersetzung mit diesen Themen, die eng mit den überlappenden Fragen nach Sicherheit, Wohlstand und Identität verbunden sind, soll eine Arbeitsgruppe eingesetzt werden, die die Infragestellung der Universalität und der Unteilbarkeit der Menschenrechte durch autoritäre Regime (und Tendenzen) und Rechtsextremismus exemplarisch aufzeigt, regressive Dynamiken benennt, Resilienzpotentiale aufdeckt und Strategien entwickelt, den genannten destruktiven Tendenzen entgegenzuwirken.
Die Arbeitsgruppe soll eine Positionierung der Deutschen Kommission Justitia et Pax zum Umgang mit der Beeinträchtigung der Menschenrechte durch den Druck durch Autoritarismus und Rechtsextremismus vorbereiten. Die Arbeit der Gruppe soll durch Veranstaltungen begleitet werden, die Resonanz für die Arbeitsergebnisse im politischen und kirchlichen Raum sowie bei anderen relevanten Akteurinnen und Akteuren schaffen soll.
Themenfeld 3 „Sozial-ökologische Transformation und nachhaltige Entwicklung“
Die Corona-Pandemie, der Angriff Russlands auf die Ukraine und die fortschreitende ökologische Dreifachkrise aus Klimawandel, Biodiversitätsverlust und Umweltverschmutzung haben die internationale Gemeinschaft bei der Erreichung der globalen Entwicklungs- und Klimaziele zurückgeworfen. Der wachsende Druck des Autoritarismus verringert die internationale Handlungsfähigkeit in diesem Feld. In einem ersten Schritt soll die Unterstützung des Projekts „Nachhaltige Entwicklung im Kontext der Agenda 2030 - die sozialökologische Transformation und der Beitrag der Kirche“ der Sachverständigengruppe Wirtschaft und Sozialethik (SVG) der Kommission Weltkirche der Deutschen Bischofskonferenz fortgesetzt werden, die sich in der vergangenen Amtsperiode erfolgreich etabliert hat. Zu diesem Zweck soll die Resonanzgruppe erneut eingerichtet werden, um die Ergebnisse der SVG in politische Aktivitäten umzusetzen und damit gesellschaftliche Debatten, insbesondere mit Vertretern und Vertreterinnen der Wirtschaft, zu qualifizieren.
II. Fortzuführende und laufende Themen
Themenfelder
Themenfeld 1„Krieg gegen die Ukraine“
Themenfeld 2 „Umgang mit gewaltbelasteter Vergangenheit/Versöhnungsprozesse – Umgang mit dem kolonialen Erbe“
Arbeitsfeld
3 „Nukleare Ab-schreckung“
Themenfeld 1 „Krieg gegen die Ukraine“
Das im Mai 2018 von Justitia et Pax veröffentlichte Arbeitspapier „Die Europäische Außen- und Sicherheitspolitik und der Russland-Ukraine-Konflikt“ soll aktualisiert werden. Das Dokument soll im Licht der neuen Erfahrungen aktualisiert und fortgeschrieben werden. Zu diesem Zweck soll eine kleine Task Force eingerichtet werden. Das Vorhaben wird voraussichtlich Mitte 2026 abgeschlossen sein.
Themenfeld 2 „Umgang mit gewaltbelasteter Vergangenheit/Versöhnungsprozesse – Umgang mit dem kolonialen Erbe“
Der Umgang mit gewaltbelasteter Vergangenheit und Versöhnung gehört seit Jahren zu den internationalen Handlungsfeldern und zum Markenkern der Deutschen Kommission Justitia et Pax. In der aktuellen Situation der Herausforderung durch den Autoritarismus kommt dem konstruktiven Umgang mit historischen Verletzungen eine neue Aktualität zu.
Im Rahmen der Kooperation mit AGIAMONDO arbeitet die Kommission an der Entwicklung eines weltkirchlichen Netzwerks zur Stärkung dieses Handlungsfeldes. Im Zusammenhang der Maximilian-Kolbe-Stiftung trägt die Kommission dazu bei, dieses Handlungsfeld in Europa zu stärken und innovative Akzente zu setzen. Diese Kooperationen sollen fortgesetzt werden.
Darüber hinaus soll die Arbeit im Themenfeld Umgang mit dem kolonialen Erbe fortgesetzt und eine entsprechende Arbeitsgruppeeingesetzt werden. Ziel der Arbeitsgruppe soll die Erstellung eines inhaltlichen Orientierungspapiers und die Entwicklung strategischer Initiativen sein.
Themenfeld 3 „Nukleare Abschreckung“
Die Deutsche Kommission Justitia et Pax hat sich in ihrer Tätigkeit wiederholt mit Nuklearwaffen befasst. Im Kontext des Ukrainekriegs wurde einmal mehr die Ambivalenz von Nuklearwaffen überdeutlich. Der alleinige und unterschiedslose Ruf nach Ächtung und Abrüstung aller Atomwaffen wird den verteidigungs- und friedenspolitischen Realitäten nicht gerecht. Da auf absehbare Zeit auf das Konzept der militärischen Abschreckung nicht verzichtet werden kann, braucht es Vorschläge, diese ohne nukleare Waffenmittel zu gewährleisten.
Eine Task-Force soll in der Tradition bisheriger Veröffentlichungen ein Grundsatzpapier zur nuklearen Abschreckung und ihrer Alternativen erarbeiten. Mit diesem Grundsatzpapier sollen auf der Ebene deutscher und europäischer Verteidigungs- und Sicherheitspolitik sowie auf Ebene der NATO politische Gespräche geführt werden. Zugleich soll sie einen Orientierungsrahmen bieten für die katholische Abrüstungsbewegung. Das Vorhaben soll bis Ende 2026 abgeschlossen sein.