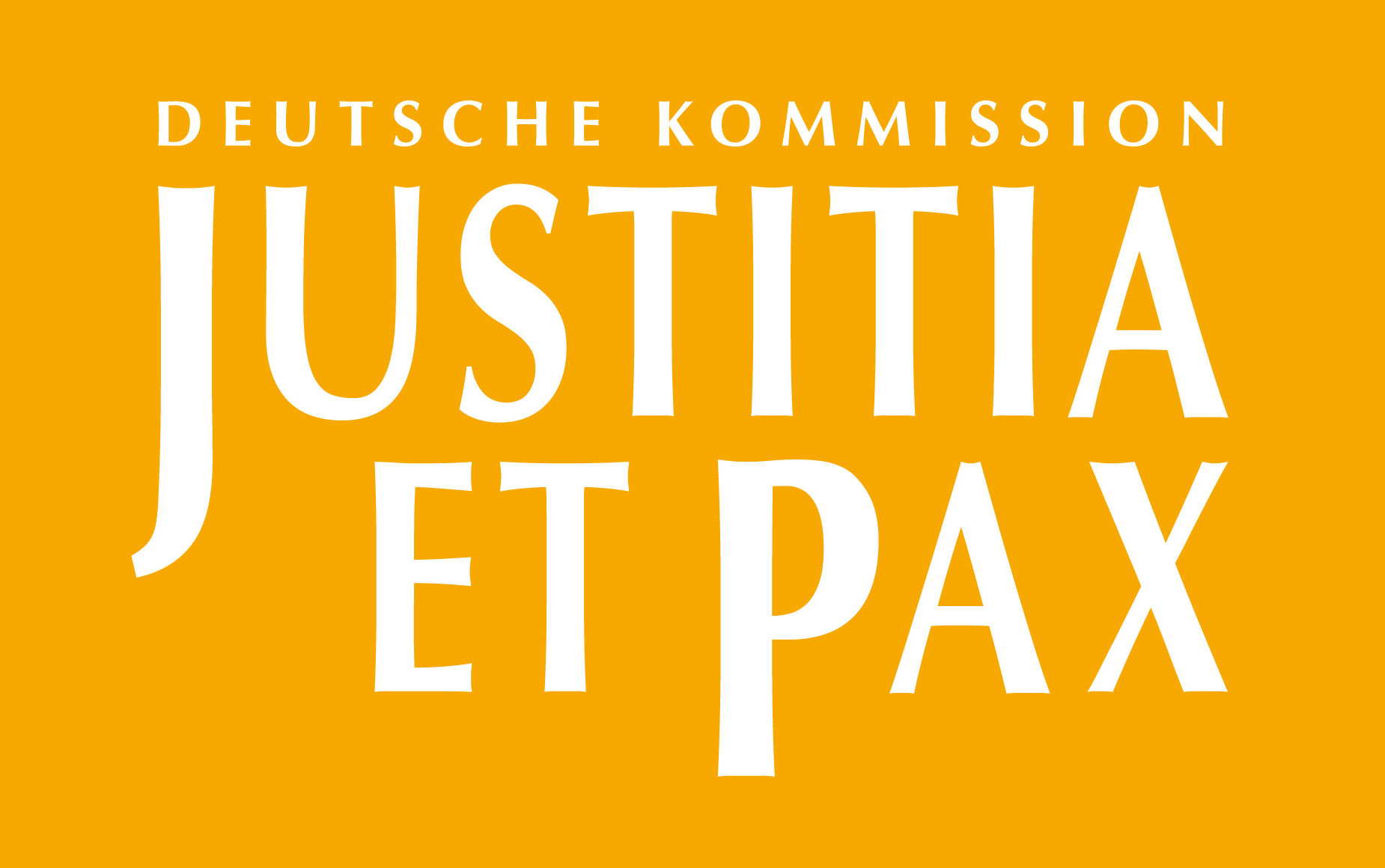Friedensethische Orientierung in politisch herausfordernden Zeiten
02.07.2025
Fachtagung zum Friedenswort der deutschen Bischöfe „Friede diesem Haus“

Nr. 109, 01.07.2025
Pressemitteilung
Heute (1. Juli 2025) endet eine zweitägige Fachtagung zum Friedenswort der deutschen Bischöfe „Friede diesem Haus“, das im Februar 2024 veröffentlicht wurde. Auf Einladung der Deutschen Bischofskonferenz, vertreten durch die Kommission Weltkirche, und der Deutschen Kommission Justitia et Pax diskutierten in Berlin etwa 40 Expertinnen und Experten der Friedensethik und Sicherheitspolitik dieses Friedenswort.
In seiner Begrüßungsansprache wies der Vorsitzende der Kommission Weltkirche, Bischof Dr. Bertram Meier (Augsburg), auf die großen Friedensbedrohungen unserer Zeit hin: „Mit großer Sorge stellen wir fest, dass Kriege wieder als reguläres Mittel der Politik angesehen werden. Die internationalen Kooperationsstrukturen, die im Ausgang des Zweiten Weltkriegs mühsam aufgebaut wurden, werden zugunsten nationaler Eigeninteressen geopfert. Der Mangel an Kooperationsbereitschaft und an einer rechte- und regelbasierten Ordnung droht die Welt ins Chaos zu stürzen.“
Der Vorsitzende der Deutschen Kommission Justitia et Pax, Erzbischof Dr. Udo Markus Bentz (Paderborn), konkretisierte in seinem Grußwort diese Friedensbedrohungen mit Blick auf die Situationen in der Ukraine und im Nahen Osten und ermutigte zu einem gemeinsamen Dienst für den Frieden: „Aus meiner Perspektive ist ,Friede diesem Haus‘ weit mehr als eine intellektuelle und auch spirituelle Auseinandersetzung mit friedenspolitischen Fragen. Der Text ist vor allem ein Anfang, sich in einer gemeinsamen Anstrengung in den Dienst des Friedens zu stellen.“
In seinem thematischen Einstieg in die Tagung legte Ulrich Pöner, Leiter des Bereichs Weltkirche und Migration im Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz, die Genese, den Kontext und die zentralen Aussagen von „Friede diesem Haus“ dar. Er führte dabei aus, dass das Friedenswort durch drei thematische Stränge charakterisiert sei: die friedenspolitische Bedeutung einer internationalen Ordnung trotz ihrer zunehmenden Erosion; die Instrumentalisierung kultureller und religiöser Identitäten in Konflikten; und schließlich die Auseinandersetzung mit den vielfältigen Gewaltphänomenen unserer Zeit.
Im Anschluss daran wurde auf der Fachtagung der Raum für vielfältige Resonanzen eröffnet. In einer ersten Einheit erhielten katholische Organisationen die Möglichkeit, aus ihrer jeweiligen Perspektive auf das Friedenswort zu reagieren. Hierbei wurden die Reflexionen des Friedenswortes zum Spannungsfeld zwischen dem christlichen Pazifismus und der legitimen Gewaltanwendung positiv hervorgehoben. Die Überlegungen des bischöflichen Wortes böten eine Möglichkeit, diese beiden friedensethischen Traditionen der Kirche in einen konstruktiven Dialog miteinander zu bringen. Gewürdigt wurde auch die realistische Gegenwartsanalyse, die nicht in einem politischen Fatalismus münde. „Friede diesem Haus“ sei vielmehr dadurch gekennzeichnet, gerade in einer Welt in Unordnung für eine kooperative und wertebasierte Friedenspolitik einzutreten. Dazu seien aber konkrete politische Handlungsempfehlungen nötig, die das Friedenswort nach Auffassung mancher Teilnehmerinnen und Teilnehmer nicht immer böte. Auch wurden die Bischöfe dazu ermuntert, aus den friedensethischen und -politischen Grundsatzreflexionen pointierte Konkretisierungen zu erarbeiten, mit denen die Kirche in einen kritischen Dialog mit der Politik eintreten könne.
Außerdem kamen verschiedene Stimmen aus der Ökumene zu Gehör. Aus dem evangelischen Bereich wurde „Friede diesem Haus“ mit Blick auf die derzeitige Arbeit an einer neuen evangelischen Friedensdenkschrift diskutiert. So zeige ein inhaltlicher Vergleich, dass es zwischen den beiden Konfessionen nur marginale Unterschiede in der Friedensethik gebe. Dies nährte bei manchen die Hoffnung auf künftige gemeinsame Friedensworte. Die Gemeinsamkeiten wurden auch vonseiten der orthodoxen Theologie betont. „Friede diesem Haus“ könne deshalb als gute Grundlage für den künftigen katholisch-orthodoxen Dialog dienen. Vertreter einer pazifistischen Friedensethik bemängelten hingegen, dass das Friedenswort zu stark auf militärische Gewalt fokussiere und die Möglichkeiten der gewaltfreien Konflikttransformation und des sozialen Widerstands kaum wahrnehme.
Die Stellungnahmen zum Friedenswort wurden durch Impulse aus der Friedensforschung und der Sicherheitspolitik abgerundet. Hierbei stand in erster Linie die Analyse des Bischofswortes im Kontext aktueller Friedensgefährdungen im Zentrum. Dr. Constanze Stelzenmüller (Direktorin des Center on the United States and Europe, Washington), Prof. Dr. Ulrich Schneckener (Vorstandsvorsitzender der Deutschen Stiftung Friedensforschung) und Generalmajor Wolf-Jürgen Stahl (Präsident der Bundesakademie für Sicherheitspolitik, Berlin) stimmten der kritischen Analyse der Bischöfe zum Zustand der internationalen Politik und Kooperationsstrukturen prinzipiell zu; sie machten darüber hinaus aber deutlich, dass sich die globalen Bedrohungen seit Erscheinen des Bischofswortes noch einmal verstärkt hätten. So seien die vielfältigen Angriffe auf die liberale internationale Ordnung in ihrer disruptiven Wirkung kaum zu unterschätzen. Eine besonders kritische Rolle spielten derzeit auch die USA, die immer weniger als Garant dieser Ordnung agierten. Angesichts dieser Entwicklungen müsse in Deutschland und Europa ein Bewusstsein für diese Friedensbedrohungen geschaffen werden, sodass sich eine gesellschaftliche Resilienz entwickeln könne. Dazu könne auch die Kirche ihren Beitrag leisten, indem sie die Fragen von Krieg und Frieden nachdrücklich in Gesellschaft und Politik einbringe. „Friede diesem Haus“ biete dazu zahlreiche Ansatzpunkte und scheue sich auch nicht, friedensethische Ambivalenzen und Spannungen zur Sprache zu bringen.
Den Abschluss der Veranstaltung bildete eine Podiumsdiskussion, die von Dr. Jörg Lüer, Geschäftsführer der Deutschen Kommission Justitia et Pax, moderiert wurde. Bischof Dr. Bertram Meier diskutierte mit Prof. Dr. Gesine Schwan (ehem. Präsidentin der Universität Viadrina, Frankfurt/Oder), Botschafter a. D. Prof. Dr. Christoph Heusgen (ehem. Vorsitzender der Münchener Sicherheitskonferenz) und Staatssekretärin a. D. Marieluise Beck (Direktorin „Osteuropa“ im Zentrum Liberale Moderne) über das Friedenswort und die aktuellen friedenspolitischen Herausforderungen. So führte Professorin Gesine Schwan aus: „Die politisch schwierige Aufgabe liegt darin, angesichts der erneuten weltweiten Gewaltbereitschaft und zum Teil imperialen Aggressivität von Politik, z. B. von Putin, Abschreckung auch durch Waffen zu sichern und doch keine Aufrüstungsspirale ohne ,Ausgang‘ zu betreiben.“ Botschafter a. D. Heusgen resümierte: „Dank der auf der deutsch-französischen Aussöhnung beruhenden Europäischen Union genießen wir die längste Periode des Friedens im Zentrum Europas. Das Recht des Stärkeren wurde abgelöst durch die Stärke des Rechts. Diese gilt es – trotz allem – auch weltweit zu bewahren.“
Hinweis
Diese Pressemitteilung wurde gemeinsam mit der Deutschen Kommission Justitia et Pax veröffentlicht.
Die Deutsche Bischofskonferenz ist ein Zusammenschluss der katholischen Bischöfe aller (Erz-)Bistümer in Deutschland. Derzeit gehören ihr 61 Mitglieder (Stand: Juli 2025) aus den 27 deutschen (Erz-)Bistümern an. Sie wurde eingerichtet zur Förderung gemeinsamer pastoraler Aufgaben, zur Koordinierung der kirchlichen Arbeit, zum gemeinsamen Erlass von Entscheidungen sowie zur Kontaktpflege zu anderen Bischofskonferenzen. Oberstes Gremium der Deutschen Bischofskonferenz ist die Vollversammlung aller Bischöfe, die regelmäßig im Frühjahr und Herbst für mehrere Tage zusammentrifft.
Impressum
Herausgeberin
Dr. Beate Gilles
Generalsekretärin der Deutschen Bischofskonferenz
Redaktion
Dr. Matthias Kopp (verantwortl.)
Pressesprecher
Kaiserstraße 161
53113 Bonn
Tel.: +49 (0) 228 103 214
Fax: +49 (0) 228 103 254
E-Mail: pressestelle@dbk.de
youtube.com/c/DeutscheBischofskonferenz
instagram.com/bischofskonferenz
Kontakt | Impressum | Newsletter abbestellen
Alle Rechte vorbehalten ©2025 Deutsche Bischofskonferenz